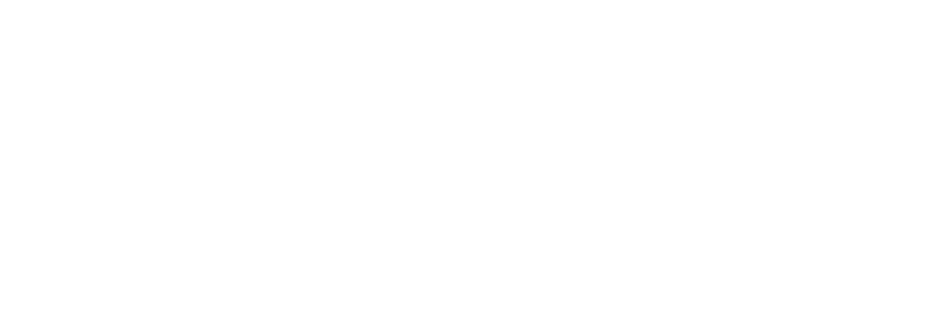Unterrichtsideen
Bildung für nachhaltige Entwicklung zielt auf eine umfassende und ganzheitliche Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt. Die sich ständig verändernden Verhältnisse zwischen Mensch, Natur und Umwelt unterliegen seit den 1950er Jahren einem enormen Beschleunigungsprozess, der erhebliche ökologische, soziale, ökonomische und kulturelle Konsequenzen nach sich zieht. Die hier gesammelten Unterrichtsmaterialien lenken den Blick auf die Beziehungen zwischen Mensch, Natur und Umwelt und regen ein vertieftes Nachdenken an. Es gehört zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, eine Transformation des Mensch-Natur-Verhältnisses so zu gestalten, dass sowohl die ökologischen Krisen der Zeit als auch globale Ungerechtigkeit eingedämmt werden. Es geht damit vor allem um die Chancen zukunftsfähiger Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch die kritische Reflexion der Spuren in der Vergangenheit.
Filtern nach Schlagwort oder Schulfach
6 Ergebnisse für die Suche nach: „CO2-Fußabdruck“
oder: Was ist eine Kilowattstunde?
Diese Unterrichtseinheit basiert auf einem Workshop, der Schüler:innen an einer Berufsschule zu sogenannten „Energiescouts“ ausbildet. Anhand von Experimenten lernen sie zunächst den Energieverbrauch an ihrer Schule kennen, beispielsweise durch nicht abgeschaltete Computer. Aus den gewonnenen Erkenntnissen entwickeln die Schüler:innen konkrete Umsetzungsideen für ihren Schulalltag.
mehr lesen- Fach: Physik (oder fächerübergreifend als Projekt)
- Schulart / Jahrgangsstufe: alle / ab Jahrgangsstufe 7
- Gruppengröße: unbegrenzt
- Zeitbedarf: 45–90 Minuten
Ein ökologischer Gallerywalk im Schulhaus
40 Fußstapfen (wasserfeste Gummimatten in einer Größe von 40 cm x 80 cm) werden an einem belebten Ort im Schulhaus ausgelegt, damit sie für alle Klassen gleich gut zu erreichen sind und zudem auch außerhalb des Unterrichts für Gesprächsstoff sorgen. Auf den Fußstapfen befinden sich Fragen zur Errechnung des eigenen Fußabdrucks. Dieser soll im Unterricht individuell ermittelt und als Grundlage für die partizipative Erarbeitung von Impulsen im Rahmen der Schulentwicklung dienen. So gelingt eine Wendung vom eher destruktiven Denkrahmens des Ökologischen Fußabdrucks hin zu einem konstruktiven Handabdruck, der Gestaltung und Engagement in den Mittelpunkt rückt.
mehr lesen- Fach: alle
- Schulart / Jahrgangsstufe: alle / ab 5. Jahrgangsstufe
- Gruppengröße: beliebig
- Zeitbedarf: Kurzvariante: 90 Minuten; auch als Langzeitprojekt möglich
Für diese Unterrichtssequenz wird das Konzept des Ökologischen Fußabdrucks im Rahmen des Mathematikunterrichts genauer beleuchtet. Nach der Bestimmung ihres individuellen Fußabdrucks wenden die Schüler:innen Bruchrechenfähigkeiten an, um ihre Ergebnisse aufzubereiten, und entwickeln so ein kritisches Verständnis für die Modellierung, die hinter diesem Konzept steckt. Schließlich steht die Frage nach den effizientesten und leichtesten Einsparmöglichkeiten im Raum.
mehr lesen- Fach: Mathematik
- Schulart / Jahrgangsstufe: Mittelschule, Realschule, Gymnasium / 6.–7. Jahrgangsstufe
- Gruppengröße: unbegrenzt
- Zeitbedarf: 4 Unterrichtseinheiten zu je mind. 45 Min.
Die Schüler:innen werden im Rahmen dieser Unterrichtseinheit durch das bewusst provokativ gewählte Thema „Insekten essen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks“ in ihren Gewohnheiten herausgefordert. Sie erweitern den eigenen Horizont und reflektieren eigene Einstellungen, die mediale Aufbereitung der Quellen sowie mögliche Handlungsalternativen kritisch.
mehr lesen- Fach: Deutsch, Geographie, Ethik, Religionslehre
- Schulart / Jahrgangsstufe: Berufliche Schulen, Mittelschule, Realschule, Gymnasium / ab 9. Jahrgangsstufe
- Gruppengröße: unbegrenzt
- Zeitbedarf: mind. 90 Min.
Produkte für einen nachhaltigen Warenkorb
In der Unterrichtseinheit reflektieren die Schüler:innen das eigene Konsumverhalten im Hinblick auf eine nachhaltige und gesundheitsbewusste Lebensweise. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf regionalen und saisonalen Produkten. Mittels eines diskursiven Zugangs erkunden die Schüler:innen die verschiedenen Produktionsweisen der Lebensmittel und reflektieren, was ökologische und regionale Produktion bedeuten und wie werbewirksam mit der Herkunft landwirtschaftlicher Produkte und der Kennzeichnung als „Bio“-Lebensmittel umgegangen wird. Als Entscheidungshilfe für den Kauf von Lebensmitteln soll den Schüler:innen der Leitsatz „Wenn nicht regional, dann wenigstens saisonal" bezogen auf Deutschland mitgegeben werden. Gemeinsam entdecken sie lebensweltnahe Handlungsmöglichkeiten, an denen sie sich bei ihren alltäglichen Konsumentscheidungen orientieren können.
mehr lesen- Fach: Deutsch, Ethik, Religionslehre
- Schulart / Jahrgangsstufe: Grundschule, Förderschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium / ab 5. Jahrgangsstufe
- Gruppengröße: unbegrenzt
- Zeitbedarf: 90 Min.
Oder: Unsere Rohstoffe erzählen, woher sie kommen
Stoffgeschichten sind narrative Zugänge zu unterschiedlichsten Rohstoffen, Elementen oder Produkten. Sie beleuchten deren Lebenszyklen, von der Gewinnung oder Herstellung über die Verwendung hin zu ihrer Entsorgung oder ihrem Verschleiß. Oft werden „Konflikt-Rohstoffe“ wie Palmöl, Soja, oder seltene Erden betrachtet, grundsätzlich gibt es aber keine Einschränkung bei der Auswahl. So lernen Schüler:innen Aspekte der Produktion von Rohstoffen kennen und schätzen die Reichweite eigener (nicht-)nachhaltiger Konsumentscheidungen und deren negative Auswirkungen auf die lokale Lage in den Regionen der Rohstoffgewinnung und auf die globale Umwelt ab. Sie beschreiben und beurteilen Aspekte der Globalisierung und differente Perspektiven von Ländern in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstadien in Bezug auf den jeweiligen Rohstoff.
mehr lesen- Gruppengröße: unbegrenzt
- Zeitbedarf: mind. 90 Min.
- Sozialform: Einzelarbeit, Gruppenarbeit und Plenum